Was ich glaub(t)eVom Kinderglauben zum erwachsenen Glauben
Vieles von dem, was wir als Kind glaubten, ist als Erwachsener unglaubwürdig. Von A wie "Auferstehung" bis Z wie "Zweifel" erscheinen hier kleine Impulse des Theologen Eckhard Raabe zum Weiterdenken über den eigenen Glauben.
Vom Kind zum ErwachsenenGlauben neu buchstabieren

Als Erwachsener darf mein Glauben nicht mehr im Widerspruch zur Vernunft stehen. Deshalb habe ich hier entlang des Alphabets meinen persönlichen Glauben neu formuliert, nicht mit Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern als Einladung, den eigenen Glauben zu formulieren.
Drücken Sie auf den Playknopf in der linken, unteren Ecke, um die Vorher-Nachher-Ansicht zu starten.
ÜbersichtText: Eckhard Raabe, Illustrationen: Annika Werner
A wie Auferstehung
Später wurde die Sache komplizierter. Wie kann einer senkrecht hochfliegen, zumal er gerade eben noch tot war? Spätestens mit solchen Überlegungen endete mein Kinderglaube an die Auferstehung. An seine Stelle trat erst einmal der Zweifel: Der Zweifel an der Himmelfahrt, am Himmel überhaupt und an den biblischen Geschichten.
Bis heute ist der Zweifel geblieben und ich weiß immer noch nicht, was hinter der Metapher der Auferstehung steckt. Ich weiß es nicht, aber ich glaube und hoffe, dass Jesus Christus uns dahin vorangegangen ist, wo wir später bei Gott sind. Das ist mein Glaube und mein Hoffen, kein Wissen.
Alle Vorstellungen von diesem Ort, an dem der Auferstandene und dann auch wir am Ende sein werden, bleiben unklar. Die Bilder, mit denen Generationen von Menschen versucht haben, den Ort darzustellen, bilden den Ort oder den Zustand nach dem Tode nicht ab. Sie befriedigen nur unsere Neugier.
Mit diesem Unwissen müssen wir leben. Aber wir kennen den Weg dorthin. Der Weg führt über die Nachfolge Jesu, über seine Nächsten- und Feindesliebe und die Hoffnung, dass sein Vater allen ein gutes Ende bereiten wird.
B wie Beten
Heute bete ich nicht mehr, jedenfalls nicht mehr so, wie man es von einem Theologen erwarten würde, mit festen Gebeten am Morgen und Abend und vor den Mahlzeiten. Dieses Beten ist mir abhandengekommen.
Dafür habe ich eine andere Form des Gesprächs mit Gott entwickelt, eine kleine Form des Gebets am Rande. Ein kleines „Oh, Gott“, wenn etwas ganz schrecklich ist, oder eine Art Gespräch mit „Gott“, irgendwo nebenbei. Dabei erwarte ich keine Antwort, meist gebe ich mir die Antworten selbst. Aber ich habe das Gefühl, dass er/sie mich hört.
Das Gespräch mit Gott, vielleicht ist es Einbildung, vielleicht tiefe Wahrheit, egal, es rückt die Verhältnisse zurecht. Ich gebe zu, dass ich nicht alles im Griff habe und dass ich Hilfe brauche. Beten ist für mich das Eingeständnis meiner Schwäche und der Beginn von Änderung.
Drücken Sie auf den Playknopf in der linken, unteren Ecke, um die Vorher-Nachher-Ansicht zu starten.
C wie Christus
Christus ist ein Titel, mit dem sich all die Hoffnung der Menschheit verband. Er wird alles gut machen. Eine große Aufgabe, auch für den Zimmermannssohn aus Nazareth. Als Sohn Gottes konnte er diese Herkulesaufgabe stemmen. Als er am Kreuz starb, war erst alle Hoffnung dahin, bis sich die Botschaft von der Auferstehung verbreitete. Die Vorstellung von Erlösung hatte sich gewandelt. Nicht mehr Befreiung von der römischen Fremdherrschaft, sondern Erlösung vom Tod.
Christus thront heute zur Rechten des Vaters im Himmel, jedoch in meiner Vorstellung nicht irgendwo über den Wolken, sondern bei den Menschen. So wie uns manche Menschen über den Tod hinaus nahe sind, ist dieser Christus der gesamten Menschheit und Schöpfung nahe. Seine Art zu leben hat den Menschen den Weg zu Gott und den Weg zum wahren Menschsein gezeigt.
Wenn Christen sagen, dass Jesus Christus lebt, dann lebt er nicht mit Herzschlag und Puls, sondern er lebt als geistiger Freund und Wegweiser, ganz lebendig. Mir erscheint er manchmal abwesend, viel zu wenig präsent in dieser Welt. Er hält sich vornehm zurück, lässt uns agieren und garantiert uns, dass sich – wenn wir in Liebe handeln – das Gute durchsetzt. An diesen Christus kann ich gerne glauben, auf ihn hoffe ich.
D wie Demut
Heute ist Demut für mich der Schlüsselbegriff für mein Christsein. Wer demütig ist, der weiß, dass er weder die große, weite Welt und nicht einmal seinen eigenen Alltag ganz beherrschen kann, der weiß, dass er angewiesen ist auf andere und seine gesamte Umwelt. Demut ist die Haltung, mit der sich der Christ in der Welt bewegen sollte.
Der sich selbst optimierende Mensch der Neuzeit hat die entgegengesetzte Haltung. Er meint, seine Ziele allein aus sich heraus erreichen zu können. Alles, was er/sie erreicht, rechnet er/sie sich als eigene Leistung zu und meint, dafür den angemessenen Lohn einstreichen zu können, sowohl finanziell wie auch im Zuwachs an Ego und Selbstbewusstsein.
Wer mit Demut durch die Welt geht, der weiß, dass das, was er leistet, nicht aus ihm allein kommt, sondern seine Wurzeln in der Geburt in ein soziales Umfeld hinein hat. Wer Demut hat, der ist dankbar für seine Familie, seine Freunde und alles Erreichte. Dankbarkeit ist die Erkenntnis in die Komplexität der Geschehen, an deren Ende Erfolg oder Misserfolg stehen. Mein Anteil daran angemessen zu bewerten, das kann ich nur mit der Haltung der Demut.
Und dann ist da die Demut gegenüber Gott, der uns erschaffen hat. Wir sind Geschöpfe und eingewoben in seine Schöpfung. Wir sind nicht ihre Krone, wir sind ein Teil der Welt und wenn wir sie jetzt im Klimawandel zerstören, dann machen wir uns zum Herren über die Schöpfung. Diese Rolle steht allein Gott zu.
E wie Engel
Auch die anderen Engel, die noch den Kosmos meiner Mutter belebten, waren verschwunden. „Du bist mein Engel“, das sagte ich höchstens noch zur Freundin und meinte damit die Erlösung, die sie mir bringen sollte. Aus meinem Leben verschwunden, schwirren Engel nur noch in den Kirchen des Barock durch die Lüfte, bringen den frommen Betern angeblich Hilfe in der Not.
Natürlich sind irgendwelche Zwischenwesen zwischen Gott und Mensch mit unserem naturwissenschaftlichen Weltbild unvereinbar. Aber schade, dass sie nicht existieren, denn sie hatten uns immer wieder daran erinnert, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das Faktische. Sie haben uns entlastet und beigestanden.
Wir neuzeitliche Menschen bleiben allein und nur manchmal erscheint uns ein anderer/eine andere als ein Engel, wenn er/sie im richtigen Moment zur Stelle ist oder das richtige sagt. In meinem Glauben sind Engel zwar auch nur Menschen, aber eben ganz besondere.
Drücken Sie auf den Playknopf in der linken, unteren Ecke, um die Vorher-Nachher-Ansicht zu starten.
Als Jugendlicher viel für mich die Fastenzeit schlicht aus. Verzicht erschien mir sinnlos. Genuss in vollen Zügen, das war meine jugendliche Divise. Erst viel später erkannte ich, dass der Gewinn beim Fasten den Verzicht bei Weitem übertrifft: Die Freiheit, Dinge anders zu machen als sonst, begann schwerer zu wiegen als der Verzicht.
Heute verzichte ich in der Fastenzeit auf Wurst und Alkohol. Auf Wurst, weil ich weiß, wie sehr mein Wurstbrötchen dem Tierwohl entgegensteht und wie sehr unsere Umwelt unter unserem Fleischkonsum leidet. Und klar: Alkohol schadet.
Also nutzt das Fasten mir und meiner Umwelt, doch was hat Gott damit zu tun? Ich glaube, er freut sich nicht an meinem Verzicht. Er freut sich mit mir an meinem Gewinn an Freiheit, an Gesundheit, an Freundlichkeit zu meiner Umwelt. Gott freut sich daran, dass ich menschlicher werde. Das ist natürlich bloß ein Bild, eine Hoffnung.
Freitags Fisch und in der Fastenzeit keine Süßigkeiten. Als Kind war das für mich irgendwie selbstverständlich, Fasten gehörte zum Wochen- und Jahresrhythmus. Es war Alltag und war dennoch irgendwie schräg. Der Fisch war lecker und überhaupt kein Opfer und der 40-tägige Verzicht auf Süßes unverständlich: Was hatte der große Gott davon, wenn ich kleiner Pimpf auf Süßes verzichte? Die Antwort auf diese Frage blieben meine Eltern mir schuldig.
G wie Gott
Gott verschwand aus meinem Weltbild und all die Gottesbilder wurden durch die Lektüre der philosophischen Religionskritiker der letzten Jahrhunderte auseinandergenommen. Gott war tot, auch für mich. Erst langsam konnte ich mir vorstellen, dass Gott irgendwo anders „wohnt“, dass er anders „ist“, als wir und die Dinge ringsum „sind“.
Gott wird. Er wird zwischen uns, wenn wir lieben. Das ist für mich die Vorstellung, mit der ich an Gott glaube, an der ich aber auch immer wieder zweifele. Denn Gott kann gar nicht so oder so sein. Er ist einfach nicht greifbar und der Gott der greifbar ist, kann nicht Gott sein. Einzig allein in Jesus Christus ist er uns erschienen, in seiner Liebe können wir erkennen, wie Gott ist.
Jesus ist das Gesicht Gottes, er hat uns gezeigt, dass in seiner endlosen Liebe zu den Menschen Gott Wirklichkeit wird und am Kreuz landet. Ein schwacher Gott, der in unserem Tun stark wird und am Ende siegt.
H wie Himmel
Ich lernte im Theologiestudium, dass Jesus statt vom Himmel vom Reich Gottes sprach. Jesus beschreibt es nicht einfach wie ein Ding, das so oder so ist. Er erzählt Gleichnisse und in den Gleichnissen erfahren wir, wie sich das Reich Gottes entwickelt. Es ist nicht einfach hier oder da, sondern es beginnt mit Jesu Auftreten in der Welt und wird größer. Es breitet sich durch unser Tun aus, wenn wir mit Liebe handeln. Mit jeder Tat, die wir mit Liebe tun, wächst es, mit jeder Tat ohne Liebe, wächst es nicht. Die Geschichte der Menschheit, wie auch unsere eigene, persönliche Geschichte ist voll von diesen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Am Ende der gesamten Menschheitsgeschichte und jeder individuellen Geschichte – so die Botschaft Jesu – steht das Reich Gottes als Vollendung von allen und allem – der Himmel auf Erden.
Der Himmel ist mit seinen Horizonten, seinen Wolken und dem Blau immer noch ein wunderschönes Symbol für diesen Endpunkt der Geschichte. Er kann von mir aus auch weiterhin als Begriff für all das Himmlische stehen. Der Ort, an dem Gott wohnt, ist er für mich jedoch definitiv nicht.
I wie I.N.R.I
Weshalb Jesus wirklich starb, darüber gibt es in der Theologie keine einhellige Meinung. Als Kind hörte ich, dass Jesus für meine Sünden starb, und ich fühlte mich schuldig, dass dieser liebe Mensch wegen mir so leiden musste. Bald verstand ich diese Opfertheologie besser: Gott opferte seinen Sohn am Kreuz, um uns von unserer Schuld zu erlösen.
Was für ein Gottesbild steckt hinter solchen Vorstellungen? Ein Gott, der seinen Sohn töten lässt, weil sonst die Schuld der Menschen nicht beglichen wird? Erst viel später lernte ich Vorstellungen vom Sterben Jesu kennen, die in seinem Tod die Konsequenz seines Lebens sahen: Jesus war ein derart liebender Mensch, dass er mit den Menschen ringsum aneinandergeraten musste.
Die Auferstehung Jesu, sein Weiterleben bei uns Menschen, hat gezeigt, dass seine Liebe den Tod überdauert und auch wir unseren Tod in dieser Weise überleben. Unsere Liebe und all die Liebe, mit der wir geliebt wurden, bleibt.
INRI – das mag damals für die Römer der Grund für Jesu Sterben gewesen sein. Für uns wird der Tod Jesu immer etwas Unverständliches bleiben. Er macht uns aber Hoffnung auf unser eigenes Leben nach dem Tode.
J wie Jenseits
Das Jenseits ist so ziemlich ganz aus dem Weltbild des modernen Menschen verschwunden. Auch in meinem Denken gibt es wenige Überbleibsel vom Jenseits, etwa in den Himmel- und Höllenvorstellungen. Der Himmel als der Ort der Seligen, die Hölle als Ort der Verdammten. Jubel und Hosianna, und ewiges Feuer und Leid.
Himmel und Hölle lagen zwar im Jenseits, warfen aber jeden Tag ihre Schatten voraus. „Dafür kommst du mal in die Hölle“, war eine durchaus übliche pädagogische Drohung in den 60iger, 70iger Jahren. Und jede gute Tat schlug sich gleich auf dem Konto der Ewigkeit nieder. Dessen positiver Kontostand war für den endgültigen himmlischen Aufenthalt die Voraussetzung.
Heute glaube ich immer noch an ein Jenseits. Es liegt für mich weder oben, noch unten, sondern in der Tiefendimension des Lebens, da, wo das Verstehen seine Grenzen hat und sich auch all die nicht greifbaren Dinge wie Liebe, Hoffnung, Trauer und Schmerz abspielen. Dort ist das Göttliche und da entscheidet sich mein Lebensweg, entscheidet sich für mich „Himmel und Hölle“. Dieses Jenseits ist nicht scharfkantig vom Diesseits getrennt, sondern es liegt ihm zugrunde. Kleinkarierte Gute- und Schlechte-Taten-Zählerei findet dort nicht statt. Es ist die Dimension Gottes, der mit seiner Liebe alles umfängt.
K wie Kreuz
Dazu passte sehr gut die strenge Miene meines Pfarrers in den 60iger Jahren. Recht machen konnte man ihm nichts und Freundlichkeit uns Ministranten gegenüber war seine Sache nicht. Entsprechend bitterernst waren die Gottesdienste, entsprechend düster auch das Bild, das die Kirche für mich in den ersten Jahren abgab.
Aber bald schon kamen andere Erfahrungen dazu. Der neue Pfarrer, der jede Predigt mit einem Witz garnierte, der Gruppenleiter, der uns Jugendlichen in den Gruppenstunden vieles ermöglichte und für den unser Spaß in der Stunde richtig wichtig war. Religion und Freude – auf einmal gehörte das irgendwie zusammen. Das Kreuz wurde leichter und in der Jugend lernte ich langsam, was es heißt, dass es für die Erlösung steht: Durch den Tod Jesu am Kreuz und die Auferweckung hat die Liebe Jesus gesiegt, so seine neue Botschaft.
Das Kreuz steht für mich heute für die Überwindung dessen, was es zeigt: Für die Überwindung des Leids. Deshalb müsste es eigentlich auch für den Jubel stehen, mit dem wir Erlösten unsere wunderbare Zukunft bei Gott feiern können. Doch so richtige Freude kommt bei mir angesichts des Leids des Mannes am Kreuz nicht auf. Das Kreuz steht für beides, für Leiden und Freude, hängt in meinem Zimmer und strahlt irgendwie eine große Kraft aus.
Drücken Sie auf den Playknopf in der linken, unteren Ecke, um die Vorher-Nachher-Ansicht zu starten.
L wie Liebe
Meine erste echte Liebe war Angela. Flugzeuge im Bauch, Herzklopfen, Liebe als Ganzköpererfahrung. In den Schlagern der 70iger Jahre war dieses Gefühl das Dauerthema: Mit „17 hat man noch Träume“, sang Udo Jürgens unschuldig und Jürgen Drews wurde konkreter: „Ein Bett im Kornfeld“. Aber Gott lieben?
Die Liebe wandelte sich und wurde zur langfristigeren Beziehung. Sie wurde erwachsener und führte zu einer Entscheidung für meine Partnerin. Auch die Gottesliebe war eine Art der Entscheidung für Gott als Lebensbegleiter, der manchmal näher, manchmal ferner ist. Wer länger verheiratet ist, der kennt diese Art der Beziehung.
Die Bibel sagt: Gott ist die Liebe. Das muss wohl eine noch größere Liebe sein, als die, die wir auf unsere menschliche Art zu empfinden in der Lage sind. Gottes Liebe zu uns Menschen und seiner Schöpfung ist vielleicht am besten mit einem Bild zu fassen: Gott umfängt die Welt. Er hält die Welt in seinen Händen.
Person geworden ist diese Liebe Gottes in Jesus Christus. Er hat die Menschen bis ans Kreuz geliebt. In der Auferweckung hat Gott diese Liebe bestätigt. Uns hat Jesus die Feindesliebe ins Stammbuch geschrieben, die Liebe, die grenzenlos ist und bei der Grenzenlosigkeit, da sind wir wieder bei der Jugendliebe und den Schmetterlingen.
Drücken Sie auf den Playknopf in der linken, unteren Ecke, um die Vorher-Nachher-Ansicht zu starten.
M wie Moral
Moral, das war in den 60iger und 70iger Jahren in der kirchlichen Lehre die Sexualmoral, also Sex und alles, was damit zu tun hatte. Das meiste davon war verboten. Immer weiter entfernte sich die kirchliche Lehre vom Tun der allermeisten Menschen und auch von mir.
Dabei ist das Feld der Moral weit. Das lernte ich im Theologiestudium. Es ist die Frage nach dem Guten, die wir uns auch im Alltag andauernd stellen müssen. Tue ich dies oder das, sage ich dies oder das, lasse ich dies oder das. Immer wieder wägen wir ab und dabei will die Moral Leitplanken geben.
Für mich klingt der Begriff der Moral auch heute noch düster. Aber ich weiß mittlerweile: Werte, wie Ehrlichkeit und Gerechtigkeit, sind bei jedem Handeln wichtig. Sie immer wieder zu bedenken, zu revidieren und neu in den Alltag zu übersetzen, ist der Weg, der zum Guten führt. Auch wenn wir dauernd scheitern, das Gute mehr oder weniger knapp verfehlen: Moralisches Handeln ist immer wieder einen Versuch wert.
N wie Neues Testament
Im Theologiestudium lernte ich mich wissenschaftlich mit den biblischen Texten zu beschäftigen, ihre Entstehung, ihre Bearbeitungen und ihre Bedeutung. Ich lernte, dass viele Autoren mit unterschiedlichen Lebensumständen und Interessen die Texte verfasst hatten, mal in biografischem Stil, mal philosophisch, mal in der Form eines Briefes.
Ihnen gemeinsam ist der tiefe Eindruck, den die Erzählungen ihrer Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannten von Leben, Tod und Auferweckung Jesu Christi gemacht hatten. Wahrscheinlich hat keiner der Autoren den historischen Jesus selbst gekannt. Trotzdem sind die Texte der erste Weg zu Jesus und damit zu Gott.
Wenn das doch so einfach wäre! Denn eindeutig sind die Texte des Neuen Testaments nicht. Sie klingen für jeden anders. Wenn das Kind beim verlorenen Sohn aufhorcht, bewegt den erwachsenen Hörer eher das Handeln des Vaters. Deshalb macht die manchmal ermüdende Wiederholung der biblischen Texte im Gottesdienst durchaus Sinn.
Im Theologiestudium wurde Gott Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzung. In Fundamentaltheologie oder Dogmatik, immer wurde Gott schon vorausgesetzt, doch er zeigte sich mir nie. Als Theologe – so glaubte ich – müsste er mir doch irgendwann erscheinen.
Die Offenbarung ist abgeschlossen, weil komplett. In Jesus Christus haben wir von Gott alles gesehen, was es zu sehen gibt.
O wie Offenbarung
In
meiner Kindheit war Gott immer da. Ich sprach mit ihm ganz selbstverständlich
und er hörte zu, glaubte ich zumindest. Irgendwann verschwand Gott als
Gesprächspartner und wurde abstrakter: Am Sonntag im Gottesdienst konnte ich
ihn noch ein wenig spüren. Aber sonst. Gott verschwand.
Im
Theologiestudium wurde Gott Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzung.
In Fundamentaltheologie oder Dogmatik, immer wurde Gott schon vorausgesetzt,
doch er zeigte sich mir nie. Als Theologe – so glaubte ich – müsste er mir
doch irgendwann erscheinen.
Im Alten Testament hatte er sich doch immer wieder geoffenbart, im brennenden Dornbusch oder in der Wolke. Manche Propheten hörten seine Stimme und ich, der Theologe von heute? Nichts.
So ist
das nun mal. Gottes Offenbarung endete vor knapp 2000 Jahren mit Jesus
Christus. Mit ihm ist die Offenbarung Gottes abgeschlossen, auch wenn immer
wieder Menschen behaupten, Gott hätte sich ihnen in irgendwelchen Visionen
gezeigt.
Die Offenbarung ist abgeschlossen, weil komplett. In Jesus Christus
haben wir von Gott alles gesehen, was es zu sehen gibt.
Auf den Punkt gebracht ist es die Liebe, die uns Jesus vorgelebt hat und die den Kern Gottes ausmacht. Mehr brauchen wir von Gott nicht zu wissen, mehr nicht zu glauben. Gott ist die Liebe, heißt es im Neuen Testament. Die Liebe, die Gott ausmacht, und wie sie sich in der Welt ausbreitet und aus ihr das Reich Gottes wird, das alles haben wir in Jesu Wirken und Reden kennengelernt. In seinem Sterben am Kreuz und der Auferstehung haben wir erfahren, dass diese Liebe selbst mit dem Tod nicht endet. Auch für uns nicht.
Q wie Quatsch
Im Grundstudium der Theologie lernte ich dann, dass auch die vier Evangelisten sich nicht einig waren. Ihre Berichte vom Geschehen um Jesus von Nazareth widersprachen sich teilweise und waren von ganz eigenen Interessen bestimmt. Wem sollte man also glauben? Dann lernte ich langsam, wie begrenzt die Auffassungsgabe unserer Logik ist. Ich lernte, das – wenn es einen Gott gibt – er jenseits von Raum und Zeit sein müsste, dass er immateriell und trotzdem eben göttlich zu denken ist.
Es wurde einerseits immer schwerer, die Widersprüche und Begrenztheit der christlichen Religion auszuhalten. Andererseits wurden sie auch bei den anderen Wissenschaften deutlicher: Was wissen wir schon vom großen Kosmos und der molekularen Welt? Wieviel haben wir bisher vom menschlichen Körper verstanden und erst recht von seiner Psyche? Auch im Alltag wurde mir immer deutlicher, dass sich alle in ihrem Leben in Widersprüche verstricken und immer wieder an Grenzen der Erkenntnis stoßen.
Im Glauben erscheint es mir so, wie überall im Leben: Ich taste mich voran, mache Fehler, lerne (oder auch nicht) und gehe weiter. Die Sicherheit im Glauben, von der ich dachte, sie würde mich einmal einholen, erreichte ich nicht. Damit ist nicht alles Quatsch, aber auch nicht alles – jedenfalls, was meinen Glauben anbelangt – für immer in trockenen Tüchern. Der Zweifel bleibt wohl für immer.
R wie Religion
Als Theologiestudent lernte ich die vielen Bereiche der Religion kennen: Die Theologie als das Gedankengebäude der Religion, die Caritas, die den Glauben in die Tat umsetzt, die religiöse Bildung, die religiöse Musik, Kunst und nicht zuletzt die riesige Institution Kirche, die den Menschen das Heil bringen soll.
Ich lernte aber auch die beiden Seiten der Religion kennen, die äußerliche und die innerliche Seite. Da die altehrwürdige Religion der Kirche mit ihren Riten und der mächtigen Institution. Und hier meine Bindung zu Gott, meine Art, den Glauben im Alltag in die Tat umzusetzen und daraus Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Da die Macht der Kirche, die mit ihren Lehrschreiben in den letzten Jahren nicht nur Gutes anrichtete. Hier die kleine, feine Religion in mir und. Da die Strenge der Kirche mit überkommenden Riten und Moralvorstellungen und hier ich, der ein Leben lang nach einem gemeinsamen Weg mit Gott gesucht hat, ein Gott der Gnade und der Liebe. Ich bin dann in der Kirche, aber auch außerhalb.
Religion ist die Rückbindung an Gott, religere heißt rückbinden, festbinden, anbinden. Ein schöner Begriff: Sich an Gott anbinden. Die im Laufe der Jahrhunderte entstandene Form der Rückbindung an Gott in der Kirche kann uns durch den Alltag tragen. Sie hilft, nicht nur wenn wir schwächeln. Aber die kirchliche Religion ersetzt nicht unsere eigene, ganz private Bindung an Gott. Den zu suchen ist unsere lebenslange Aufgabe.
S wie Sexualmoral
Natürlich entschied ich mich für die Liebe, gegen den Pfarrer. Die Kirche wurde mir fremd, je öfter ich die Sexualität als etwas erlebte, was meine Beziehung zu meiner Freundin stärkte. Wie sollten diese himmlischen Erfahrungen etwas Sündiges sein, nur weil wir keinen Trauschein hatten?
Dann kam die Befreiung. Mein Professor für Moraltheologie, ein ehrenwerter, renommierter Theologe, brachte seine Vorstellung einer guten Sexualmoral auf den Punkt: „Es ist wie im Straßenverkehr: Solange niemand verletzt wird, ist es okay.“ Ein einfacher Satz, aber ihn in die Tat umzusetzen, kann sich als einigermaßen schwierig erweisen, gerade wenn man die seelische Verletzung dazurechnet. Bis heute tut sich die Kirche schwer damit, Normen aufzustellen, die Paaren als sexuelle Menschen wirklich in ihrem Alltag helfen.
Dabei wachsen heute Jugendliche mit Pornos im Internet auf, in denen Frauen erniedrigt und missbraucht werden. Da wäre die hilfreiche Stimme der Kirche nötig, die den Jugendlichen die schlechten Vorbilder überwinden und als Paare eine eigene Sexualität entwickeln helfen. Verbote helfen da nicht.
Ich hoffe, dass irgendwann wieder die Mitarbeiter/innen der Kirche gerade für Jugendliche zu Gesprächspartnern in Sachen Sex werden. Derzeit tun sie sich da schwer.
T wie Tod
T wie Tod

Für Christen ist der Tod der Übergang zu neuem Leben bei Gott. Der Tod ist ein Durchgang und wird oft als Tunnel mit einem Licht am Ende dargestellt. Auch wenn dieses Licht noch so hell leuchtet: Auch der frommste Christ will nicht sterben, denn sicher, dass da nach dem Ende etwas Wunderbares ist, kann sich niemand sein.
So ist der Tod im Leben eine ständige Bedrohung und der Grund für unzählige Sicherungssyteme: Die Lebensversicherungen, der Gurt im Auto und die Obacht auf die an der Straße spielenden Kinder. Überall sichern wir unser Leben ab. Auch die Religion hatte über Jahrhunderte hinweg diese Funktion. Sie sicherte das Leben über den Tod hinaus. Die Sicherheit, mit der unsere Vorfahren von einem Leben nach dem Tod ausgingen, konnten sie sich mit einem frommen Leben erwerben. Gott war der gerechte Richter, der nach den guten Taten richtete. Damit räumte Luther auf.
Heute ist der direkte Zusammenhang vom gottgefälligen Leben und dem Leben nach dem Tod schwierig geworden. Gott richtet nicht wie ein Richter am Strafgericht nach guten und schlechten Taten. Er macht – so die christliche Hoffnung – uns Menschen gerecht und vollendet unser Leben in dem, was ihm gefehlt hat. Aber auch wenn ich daran glaube, dass es ein Leben nach dem Tod geben kann, sicher bin ich mir nicht. Ich hoffe nur, dass es dieses Leben gibt, besonders für alle, die sterben und die ich liebe.
U wie Unfehlbarkeit
Später dann hörte ich im Theologiestudium vom Dogma der Unfehlbarkeit. Glaubenssätze, die vom Papst explizit ex cathedra verkündet werden, sollen geglaubt werden müssen, so die damalige Entscheidung des 1. Vatikanischen Konzils 1870. „Glauben müssen“, immer noch der alte Widerspruch und natürlich gab es eine Reihe von Bischöfen, die dieses Dogma denn auch nicht unterstützten. Bis heute halten es viele Theologen selbst für falsch, trotz Unfehlbarkeit. In den letzten Jahrzehnten wurden immer häufiger auch einfache Lehrschreiben aus Rom mit höchster Verbindlichkeit formuliert, quasi als unfehlbar.
Klar ist, dass nicht alles und jedes wahr sein kann, wenn man an den einen Jesus Christus als den Erlöser glaubt. Wer etwa nicht an seine Auferstehung glaubt, der dürfte sich nicht als Christ/in bezeichnen. Dennoch tun das viele, wie Umfragen zeigen. Kein Wunder, haben sich doch oft die Vorstellungen, die hinter den dogmatischen Formulierungen, auch der Auferstehung, stehen, gewandelt.
Dass die Kirche als Ganze auf dem richtigen Weg ist, das ist meine feste Hoffnung. Dass sie in Glaubens- und Sittenfragen, wie es so schön heißt, immer richtig liegt, bleibt umstritten. Gerade an der Segnung homosexueller Paare kann man sehen, dass eine Basta-Mentalität auch in der Kirche nicht mehr funktioniert. Für viele gibt es eben nicht mehr nur die eine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten. Zu guter Letzt entscheidet sich mein Christsein nicht am Fürwahrhalten von Sätzen. Es bewahrheitet sich im Handeln.
V wie Vater
Der Gott Jesu war anders. Zärtlich sprach er von seinem Vater als Abba und das war auch für mich die andere Seite meines Vaters, die zärtliche Seite. In seinen Armen konnte ich beruhigt einschlafen. Mein Vater starb früh und mein Bild vom Vater wurde nie richtig erwachsen. Der große Abstand zwischen ihm und mir blieb für mein Leben bestehen. Dieser Abstand bestand für Jesus nicht: „Wer mich sieht, sieht den Vater“, sagt Jesus.
Und das ist für mich das Entscheidende bei diesem Vater Gott Jesu: Er ist eben nicht der überlegene, der strafenden, sondern der gütige, vergebende Gott. Der Gott Vater Jesu ist einer, der in unserem Tun groß und mächtig wird. In unserem Handeln wächst sein Reich, das Reich Gottes. Gott regiert nicht als mächtiger Herrscher oben im Himmel, sondern ist ohnmächtig mittendrin in unserer Welt, ohnmächtig bis zum Kreuz.
Mutter war Gott für mich nie, aber da lerne ich von den Frauen heute, die die mütterliche Seite Gottes betonen, die liebende, die lebensspendende Seite Gottes. Für sie ist Gott Vater und Mutter in einem. Ich glaube, dass Gott über diesen Geschlechtergrenzen steht. Und am Ende ist Gott dann doch ein ganz anderer und all die Bilder, auch das der Mutter wird sich als unzureichend herausstellen und wir werden ihn/sie sehen. Ich bin gespannt.
W wie Weihrauch
Wozu der Weihrauch gut ist? Klar, er macht auch aus einer noch so schlichten Betonkirchen einen erhabenen Raum. Die Gottesdienste an den Hochfesten wirken gewichtiger, hinter dem Rauchschleier erscheint die Liturgie als ein ganz besonderes Mirakel.
Und das ist es eben nicht. Denn Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, dass wir uns gemeinsam an ihn erinnern. Das Brot und der Wein, die wir nach der Wandlung zu uns nehmen, sind bis heute wohl sie stärksten Zeichen für eine Verbindung: Jesus Christus kommt in unseren Körper, wir werden eins.
Da braucht es eigentlich keinen Weihrauch, um diese starke Erfahrung der Gemeinschaft mit Christus und untereinander zu betonen. Aber trotzdem: Der Duft bei den Hochfesten ist eben auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht allein mit unseren Gedanken Gottesdienst feiern, sondern mit dem ganzen Körper. Der Wohlgeruch verstärkt die Erfahrung eines an sich schon starken Ereignisses.
Z wie Zweifel
Wie zwei Brüder (oder Schwestern) stehen sich beide, Glaube und Zweifel, sehr nahe, so nahe, dass sie auf dem Lebensweg hin zu einem vertieften Glauben führen, bloß mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Zerrissenheit zwischen Glauben und Zweifeln habe ich mein Leben lang auch als Theologe gespürt. Zu billig sind mir manche Predigten.
Wahrscheinlich waren die Zweifel bei meinen Eltern und Großeltern genauso groß wie bei mir heute, wurden aber – wie so vieles in der bürgerlichen Welt des letzten Jahrhunderts – totgeschwiegen. Ob dadurch der Glauben gestärkt und der Zweifel geschwächt wurde? Ich glaube nicht. Ich versuche beides, Glauben und Zweifel, zuerst einmal wahrzunehmen. Gerade das in der Religion, was dem neuzeitlichen Verständnis der Welt entgegensteht, ist mir heute verdächtig und kann aus meiner Sicht getrost bezweifelt werden.
Dass wir das Geheimnis Gottes am Ende wie eine Gleichung auflösen werden, denke ich nicht. Dennoch hoffe ich, ihm immer weiter auf die Spur zu kommen. Der Zweifel ist dabei ein ständiger Wegbegleiter.



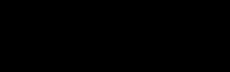


























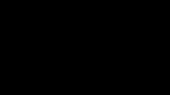
























 Was ich glaub(t)e
Was ich glaub(t)e
 Glauben neu buchstabieren
Glauben neu buchstabieren
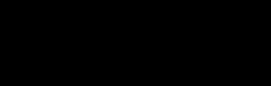 Übersicht
Übersicht
 A wie Auferstehung
A wie Auferstehung
 B wie Beten
B wie Beten
 C wie Christus
C wie Christus
 D wie Demut
D wie Demut
 E wie Engel
E wie Engel
 F wie Fasten
F wie Fasten
 G wie Gott
G wie Gott
 H wie Himmel
H wie Himmel
 I wie I.N.R.I
I wie I.N.R.I
 J wie Jenseits
J wie Jenseits
 K wie Kreuz
K wie Kreuz
 L wie Liebe
L wie Liebe
 M wie Moral
M wie Moral
 N wie Neues Testament
N wie Neues Testament
 O wie Offenbarung
O wie Offenbarung
 P wie Paradies
P wie Paradies
 Q wie Quatsch
Q wie Quatsch
 R wie Religion
R wie Religion
 S wie Sexualmoral
S wie Sexualmoral
 T wie Tod
T wie Tod
 U wie Unfehlbarkeit
U wie Unfehlbarkeit
 V wie Vater
V wie Vater
 W wie Weihrauch
W wie Weihrauch
 Z wie Zweifel
Z wie Zweifel